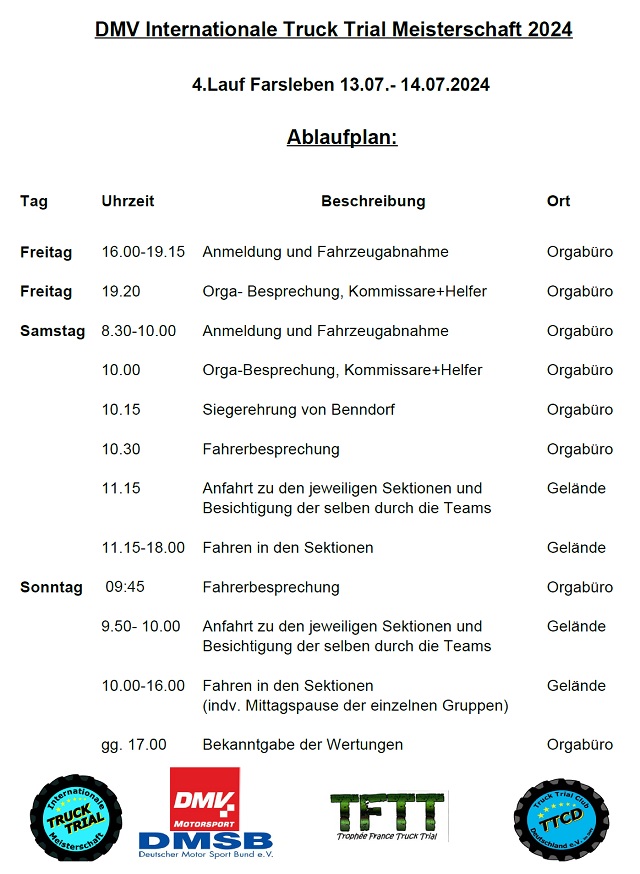NRW-Ministerin Silke Gorißen: „Veltins ist tragende Säule der NRW-Ernährungswirtschaft“
Meschede-Grevenstein (ots)
- Reinheitsgebot steht für qualitätsvolle Zutaten im Bier
- Nordrhein-Westfalen verzeichnet zweithöchsten Bierabsatz
Bei einem Besuch der Brauerei C. & A. Veltins hat sich die NRW-Landwirtschafts- und Verbraucherschutz-Ministerin Silke Gorißen über die Innovationsstärke von Veltins im 200. Jahr des Bestehens informiert.

Im Beisein der Veltins-Geschäftsführer Dr. Volker Kuhl (Marketing/Vertrieb) und Peter Peschmann (Technik), der Landtagsabgeordneten Matthias Kerkhoff und Dagmar Hanses sowie Landrat Dr. Karl Schneider wurden die neuen Brau- und Abfüllanlagen am Stammsitz Grevenstein in Augenschein genommen. „Wir legen seit jeher Wert auf beste Rohstoffe und setzen deshalb traditionell erntefrischen Hopfen ein, um bewusst auf Hopfenextrakt zu verzichten“, so Dr. Kuhl. Die 200 Jahre alte Brauerei legt bei der Herstellung Wert auf regionale Zutaten, etwa auf das weiche Quellwasser aus sieben hauseigenen Quellen. Das Familienunternehmen gehört nach Ministeriumangaben damit zur leistungsstarken Ernährungsbranche Nordrhein-Westfalens, die Lebens- und Genussmittel regional produziert, welche bundesweit und international bekannt und geschätzt sind. In Nordrhein-Westfalen arbeiten rund 140.000 Menschen in diesem Wirtschaftszweig – einschließlich Zulieferern, Verarbeitern und Handel.
Verlässlicher Arbeitgeber in Nordrhein-Westfalen

Ministerin Silke Gorißen würdigte den Unternehmenserfolg: „Das Lebensmittelhandwerk ist eine tragende Säule in Nordrhein-Westfalen. Dazu gehört auch das Brauhandwerk. Seit 200 Jahren braut Veltins in Meschede mit hochwertigen Zutaten wie Malz, Hopfen, Hefe und reinem Quellwasser aus der Region nach deutschem Reinheitsgebot – und zählt heute zu den modernsten Privatbrauereien Europas. Die familiengeführte Brauerei hat sich über die Jahre zu einem wichtigen und verlässlichen Arbeitgeber in der Region entwickelt und bietet rund 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz. Zu diesem Meilenstein gratuliere ich ganz herzlich.“ Dr. Kuhl, Geschäftsführer Marketing/Vertrieb der Brauerei C. & A. Veltins, zeigte sich zuversichtlich, dass der Biermarkt noch genügend Raum für Wachstum biete, wenngleich die Rahmenbedingungen unverändert schwierig seien: „Es ist gut zu wissen, dass die NRW-Landesregierung den intensiven Dialog mit den Mittelstandunternehmen des Landes sucht, um zu wissen, wo der Schuh drückt. Gerade die Ernährungswirtschaft besitzt in Nordrhein-Westfalen eine traditionsreiche Verankerung, um die Versorgung mit qualitätsvollen Lebensmitteln jederzeit sicherzustellen.“
NRW bleibt ein Schwergewicht im deutschen Biermarkt
Nach Bayern mit einem Bierabsatz von 23,36 Mio. hl entstammen den nordrhein-westfälischen Sudkesseln 21,23 Mio. hl und damit rund ein Viertel des deutschen Gesamtabsatzes. Nordrhein-Westfalen zeigt sich mit einem vergleichsweise moderaten Absatzrückgang von -2,5% (548.480 hl) im Ländervergleich als erfreuliche Ausnahme. Allein an den drei Standorten Meschede-Grevenstein (Veltins), Kreuztal-Krombach (Krombacher) und Dortmund (Brinkhoff’s, DAB) wird die Hälfte des NRW-Bieres gebraut, die anderen 139 Braustätten im Land teilen sich die andere Hälfte des Absatzes. Die Präferenz für Pilsener-Biere besitzt im NRW-Markt eine unverändert feste Verankerung, Verbraucher setzen weiterhin auf die bewährte Qualität und Tradition dieses Bierstils. Mit einem dominanten Anteil von 54,8% aller verkauften Biere besitzt Pils auch in den Handelsregalen des bevölkerungsstärksten Bundeslandes die klare Führungsrolle. Auf Platz zwei folgt laut AC Nielsen die lokale Spezialität Kölsch mit 8,2% vor alkoholfreien Bieren mit 7,7% Absatz. Trotz aller dynamischer Veränderungen im Biermarkt bleibt in Nordrhein-Westfalen eines konstant: Die Bierfreunde zwischen Rhein und Weser legen nach wie vor Wert auf umweltfreundliche Einkäufe mit einem beeindruckenden Mehrweganteil von rund 83%. Im Jahr 2023 blieb die Halbliterflasche das bevorzugte Gebinde. Mit 48,1% kommt der größte Teil des verkauften Bieres in NRW in der 0,5-l-Flasche zum Kunden – der Großteil im Kasteneinkauf.
705 Mio. Euro in Standort und Produkte investieren
Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums der Brauerei C. & A. Veltins warf Dr. Volker Kuhl, Geschäftsführer Marketing/Vertrieb, einen Blick auf die letzten 25 Jahre der Entwicklung des Unternehmens. „Unsere Brauerei hat durch Beständigkeit und Verbrauchernähe den Weg in Richtung Marktspitze vollzogen und ist damit ein wichtiger Player im NRW-Biermarkt geworden.“ Mit Weitsicht und Beharrlichkeit habe das Familienunternehmen die Konsum- und Branchenveränderungen in Handel und Gastronomie mitgestaltet. So hat sich der Veltins-Bierausstoß in den letzten 25 Jahren um +38,7% auf rund 3,3 Mio. hl erhöht, während der deutsche Biermarkt in der gleichen Zeit über 25% an Menge verloren hat. „Es ist gelungen, qualitativ und nachhaltig unsere Premium-Positionierung auszubauen. Mit einem Umsatzzuwachs von +126,4% konnten wir die Produktpräferenzen in Markenwert ummünzen.“ Der Brauerei sei es in all den Jahren nicht um Menge, sondern vor allem auch um Stabilität und Ertragskraft gegangen. „Die vollzogene Investitionsoffensive von rund 420 Mio. Euro wurde allein aus dem Cashflow finanziert.“ In den letzten 25 Jahren wurde damit eine Gesamtsumme von 705 Mio. Euro in Standort und Produkte investiert.
Weitere Informationen der Brauerei C. & A. VELTINS im Internet
verfügbar: www.bierpresse.de, www.veltins.de, www.vplus.de